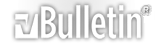Die drei Phasen auf dem Weg zur Sucht
Die drei Phasen auf dem Weg zur Sucht
Eine Spielerkarriere bildet sich nicht von heute auf morgen, sondern entwickelt sich langsam.
1. Die erste Phase
Am Anfang steht die Gewinnphase. Du spielst ab und zu mal und kannst mal größere, mal kleinere Gewinne ergattern. Das bringt ein gutes Gefühl; und auch beim Spielen bist du positiv erregt. Aber dein Optimismus ist nicht mehr realistisch und du lebst in einer Wunschwelt. Du beginnst, immer häufiger zu spielen und tätigst immer höhere Einsätze.
2. Die zweite Phase
Das zweite Stadium ist die Verlustphase. Du beginnst, Verluste zu machen, aber bagatellisierst diese. Wenn du einen Gewinn machst, verlierst du dich in Prahlerei. Immer noch gelingt es dir, deine Verluste auszugleichen, aber du spielst immer häufiger und denkst sogar ständig ans Spielen. Dann kommen die ersten größeren Verluste und es beginnen die Heimlichkeiten. Um Freunde und deine Familie kümmerst du dich nicht mehr und beschäftigst dich sogar an deinem Arbeitsplatz mit dem Spiel. Du leihst dir Geld, nimmst Kredite auf und kannst dem Spiel nicht mehr widerstehen.
3. Die dritte Phase
Die dritte Phase ist die Verzweiflungsphase. Du beschäftigst dich nur noch damit, irgendwo Geld herzubekommen. Wenn es darum geht, die Schulden zurückzubezahlen, dann hältst du Vereinbarungen nicht ein. Auch deine Persönlichkeit ändert sich; du wirst reizbar, ruhelos, irritiert und hast Probleme beim Schlafen. Familie und Freunden entfremdest du dich total, vom gesellschaftlichen Leben ziehst du dich zurück. Das hat zur Folge, dass du deinen gesellschaftlichen Status verlierst.
Wenn du Zeit und Geld hast, dann verwendest du es ausschließlich zum Spielen. Manchmal können diese Sessions tagelang gehen. Aber dann quälen dich Gewissensbisse. Am Ende überfallen dich Gefühle der Hoffnungslosigkeit und es kann auch zum Selbstmord führen.
Wie entsteht zwanghaftes Spielverhalten?
Nicht jeder, der oft und gern Poker spielt, ist automatisch spielsüchtig, denn bei pathologischem Spielverhalten handelt es sich um einen sehr komplexen Vorgang. Viele Faktoren spielen beim Entstehen des Problems eine Rolle.
Sehr wichtig dabei sind aber folgende Faktoren:
• Störung des Selbstwertgefühls
• Störungen der Beziehungsfähigkeit
• Fehlregulationen, was die Erregung betrifft
Störung des Selbstwertgefühls
Diese Gefühle sind oft tief in der Kindheit verwurzelt, als Machtlosigkeit oder Minderwertigkeit empfunden wurden. Der Betroffene hat beim Spielen das Gefühl der Allmacht und der Größe.
Vor allem wenn Gewinne gemacht werden, wird das Selbstwertgefühl bestärkt. Ein großer Gewinn allerdings kann dafür sorgen, dass man sich in eine Fantasiewelt begibt.
Störung der Bindungsfähigkeit
In der Psychologie ist der Name John Bowlby ein Begriff. In seinen Abhandlungen beschreibt er verschiedene Bindungstypen.
Darunter befindet sich auch der unsicher-vermeidende Bindungstyp. Das bedeutet, dass die Kinder Angst davor haben, dass ihre Bezugsperson nicht mehr für sie da sein könnte. Besonders häufig findet man das, wenn die Kinder oft Zurückweisungen erleben mussten.
Bei pathologischen Spielern findet man sehr häufig die sogenannte „broken-home“-Situation. Darunter fallen gestörte Beziehungen zum Vater oder gar Erfahrungen des Missbrauchs.
Fehlregulationen, was die Erregung betrifft
Damit ist gemeint, dass man innere Anspannung nicht mehr regulieren kann. Das äußert sich darin, dass der Spieler oft ruhelos ist, denn das Spiel hat den Zweck, negative Gefühle zu bekämpfen. Die Bereiche des Lebens der Betroffenen zerbrechen oft an der Sucht.